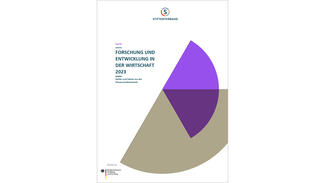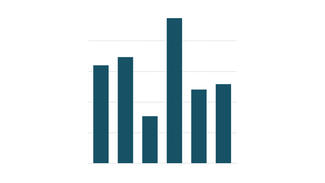
Forschung und Entwicklung
Im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) erhebt die Wissenschaftsstatistik des Stifterverbandes jedes Jahr die offiziellen Daten zu Forschung und Entwicklung der Unternehmen und Institutionen für Gemeinschaftsforschung in Deutschland.
ERHEBUNG ÜBER FORSCHUNG UND ENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFT IN DEUTSCHLAND
IM JAHR 2024 – ERSTE ERGEBNISSE
Die Unternehmen in Deutschland haben im Jahr 2024 ihre Ausgaben für selbst durchgeführte Forschung und Entwicklung nur geringfügig erhöht. Gegenüber dem Vorjahr steigen sie um 2,3 Prozent auf insgesamt 92,5 Milliarden Euro und damit etwa im Rahmen der Inflationsrate. Dies zeigen neue Daten, die der Wissenschaftsstatistik im Stifterverband jährlich im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) erhebt. Doch die Unterschiede zwischen den Branchen sind groß: Während Unternehmen der Softwareentwicklung ihre internen FuE-Aufwendungen weiterhin erhöhten, hat die pharmazeutische Industrie die Aufwendungen reduziert.
Seit Einführung dieser offiziellen Erhebung in den 1970er-Jahren ist die Wissenschaftsstatistik im Auftrag des Bundesministeriums für Forschung, Technologie und Raumfahrt (BMFTR) für deren Konzeption und Durchführung verantwortlich. Seitdem werden regelmäßig Informationen über die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten (FuE) des Wirtschaftssektors in Deutschland bei allen forschenden und forschungsverdächtigen Unternehmen erhoben. Die Erhebung ist Teil der offiziellen EU-Gemeinschaftsstatistiken und fließt in nationale wie internationale Berichtssysteme ein.
Kernindikatoren sind die finanziellen Aufwendungen für die von den Unternehmen selbst durchgeführte (interne) Forschung und Entwicklung sowie die im Rahmen von FuE-Aufträgen an Externe vergebenen Aktivitäten. Die Daten lassen sich etwa nach Mittelverwendung und Finanzierungsquelle oder auch nach Empfängergruppen im Fall der Vergabe von FuE-Aufträgen analysieren. Ebenso werden zahlreiche Indikatoren für den Bereich des FuE-Personals abgefragt, etwa nach Art der ausgeübten Tätigkeit und Geschlecht. Zudem spielen Fragen zur regionalen Verteilung der Forschungsstätten, den beforschten Technologiefeldern, den Ergebnissen der FuE-Aktivität, also zur Innovationstätigkeit der Unternehmen sowie betriebswirtschaftliche Kennzahlen eine Rolle.
Die FuE-Erhebung folgt internationalen Standards der Europäischen Union und der OECD. Dementsprechend sind die Daten nach Branchen, Regionen oder Unternehmenstypen nicht nur national, sondern auch international vergleichbar. Sie sind ein zentraler Bestandteil der Berichterstattung Deutschlands zur technologischen und innovatorischen Leistungsfähigkeit im Inland sowie in der EU und in der OECD.
Die Ergebnisse der FuE-Erhebung 2023
Trotz bestehender wirtschaftlicher Unsicherheiten aufgrund eines rückläufigen Wirtschaftswachstums ist die Entwicklung im Bereich Forschung und Entwicklung (FuE) weiterhin positiv. Insgesamt sind im Jahr 2023 mehr als 90 Milliarden Euro in interne FuE-Aufwendungen geflossen – eine Marke, die zum ersten Mal überschritten werden konnte. Auch der Anteil der FuE-Ausgaben am Bruttoinlandsprodukt (BIP) ist im Vergleich zu den Vorjahren weiter gestiegen und liegt nun bei 3,10 Prozent. Nach einem Absinken der Aufwendungen im Jahr 2020 aufgrund der COVID-19-Pandemie sind die FuE-Aufwendungen fast wieder auf das Vorkrisenniveau gestiegen. Das Erreichen des 3,5-Prozent-Ziels scheint jedoch trotz des stetigen Anstiegs der FuE-Aufwendungen weiterhin herausfordernd. Der große Sprung blieb aus, vermutlich wesentlich aufgrund wirtschaftlicher Unsicherheiten. Im europäischen Vergleich gehört Deutschland weiterhin zur Spitze bei den FuE-Ausgaben und liegt mit seinem Anteil am BIP deutlich über dem EU-Durchschnitt von 2,22 Prozent.
Der Wirtschaftssektor verzeichnet mit einem Anstieg von 2,07 auf 2,12 Prozent den größten Sprung und stellt damit weiterhin den mit Abstand größten Anteil an den gesamten FuE-Aufwendungen. Allerdings wird das Niveau von 2,15 Prozent im Berichtsjahr 2019, dem Jahr vor der COVID-19-Pandemie, im Wirtschaftssektor bisher noch nicht wieder erreicht. Der Hochschulsektor zeigt mit 0,54 Prozent einen leichten Rückgang um 0,02 Prozentpunkte zum Vorjahr. Bei den privaten Institutionen ohne Erwerbszweck (PNP) und dem staatlichen Sektor gab es im Vergleich zum Jahr 2022 keine Veränderung. Seit 2022 werden die Sektoren Staat und PNP getrennt ausgewiesen. Dadurch sinkt der Anteil des staatlichen Sektors im Vergleich zu den Vorjahren.
Ein Blick in die aktuellen Daten der Erhebung aus dem Berichtsjahr 2023 zeigt, dass die absoluten Zahlen der internen FuE-Aufwendungen zum ersten Mal die Marke von 90 Milliarden Euro übertroffen haben. Dies entspricht einer Veränderung zum Vorjahr von mehr als 10,5 Prozent und ist die höchste Steigerung der letzten 20 Jahre. Ein wesentlicher Grund für diesen Anstieg dürfte in den hohen Inflationsraten der Jahre 2022 (6,9 Prozent) und 2023 (5,9 Prozent) liegen, die sich unter anderem in gestiegenen Materialbeschaffungs- und Lohnkosten im FuE-Bereich widerspiegeln (Statistisches Bundesamt 2025). Die tatsächliche Wachstumskraft wird durch die Inflationsrate also teilweise relativiert. Die absoluten Zahlen der Beschäftigten bestätigen allerdings den positiven Trend und weisen mit insgesamt 543.452 Vollzeitäquivalenten einen Anstieg um 7,6 Prozent im Vergleich zum Erhebungsjahr 2022 auf.
Die externen FuE-Aufwendungen sind im Jahr 2023 mit 15 Prozent deutlich gestiegen und liegen nun bei 31,8 Milliarden Euro, was einem Rekordanteil von 26 Prozent an den gesamten FuE-Aufwendungen entspricht. Der große Sprung bestätigt den Trend im Anstieg der Ausgaben für externe Forschung und Entwicklung, der seit vielen Jahren beobachtet werden kann: Die Bedeutung von externer FuE wird in Deutschland bereits seit 30 Jahren stetig größer. Doch wie bewerten Unternehmen selbst diese Entwicklung? In der aktuellen Erhebung gehen 34,7 Prozent der antwortenden Unternehmen davon aus, dass sich das Verhältnis zwischen internen und externen FuE-Aufwendungen nicht weiter ändern wird. Nur 9,7 Prozent rechnen mit einer weiteren Zunahme der externen gegenüber den internen FuE-Aufwendungen. Trotz des deutlichen Anstiegs externer FuE in den letzten Jahren gibt etwa die Hälfte der Unternehmen an, dass sie bisher keine externen FuE-Aufträge vergeben. Dies verdeutlicht, dass interne FuE für viele Unternehmen nach wie vor eine größere Bedeutung hat.
Insights mit einer ausführlichen Analyse
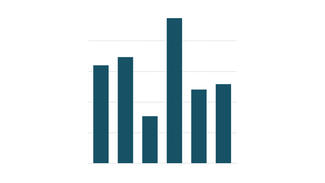
Daten und Methodik
Grundlage für die jährliche FuE-Erhebung bilden die Regeln der Europäischen Kommission: Diese umfassen die EU-Verordnung 2019/2152 sowie die entsprechende Durchführungsverordnung (EU) 2020/1197. Darüber hinaus orientiert sich die verwendete Methodik an der aktuellen Version des Frascati-Handbuchs, das von den OECD-Mitgliedsstaaten für eine einheitliche Standardisierung der internationalen FuE-Erhebungen entwickelt wurde (OECD, 2018), und den methodischen Empfehlungen von Eurostat.
Die Zielgruppe der FuE-Erhebung umfasst branchenübergreifend alle FuE-aktiven Unternehmen in Deutschland mit mindestens einem Beschäftigten (durchschnittliche Kopfzahl im Berichtsjahr der Erhebung). Da in Deutschland kein allgemeines Verzeichnis der FuE-treibenden Unternehmen existiert, ist die Erstellung und Pflege eines solchen Verzeichnisses ein wesentlicher Bestandteil der Datenerhebung. Derzeit befinden sich im Gesamtadressbestand circa 34.000 Unternehmen, die FuE durchführen oder bei denen ein solcher Verdacht besteht. Dieser aktive Bestand ist die Grundlage zur Bildung der Grundgesamtheit der befragten Unternehmen. Die Befragung ist im Kern als Onlineerhebung konzipiert.
Im Forschungsdatenzentrum Wissenschaftsstatistik sind die Mikrodaten über Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten der deutschen Wirtschaft ab dem Jahr 1995 auf Unternehmensebene zu Forschungszwecken verfügbar.
Publikationen
Veranstaltungen

Fachkräftemangel? Welcher Fachkräftemangel?
Die Wissenschaftsstatistik hatte für den 7. November 2024 zum FuE-Workshop nach Berlin eingeladen: Im Zentrum stand die Frage, wie es forschenden Unternehmen in Zeiten von Fachkräftemangel gelingt, Personal anzuziehen. Dabei wurden Praxisfälle aus Unternehmen diskutiert, Best-Practice-Ansätze herausgearbeitet und konkrete Maßnahmen vorgestellt, um dem Qualifizierungsbedarf zu entsprechen.
Mehr Info zur Veranstaltung
Der FuE-Workshop 2022 stand unter dem Titel "Wissenstransfer bei Technologischen und Sozialen Innovationen: Alte Probleme und neue Lösungen?" und fand in Essen statt.
Mehr Info
Der FuE-Workshop 2021 beschäftigte sich mit dem Thema "Was bleibt von der Pandemie? Der langfristige Einfluss der Krise auf den deutschen Forschungsstandort".
Mehr Info
Der FuE-Workshop 2019 drehte sich um die technologische Diversifizierung Deutschlands beim Strukturwandel hin zu neuen Spitzentechnologiefeldern im Umfeld bereits vorhandener Innovationsschwerpunkte.
Mehr Info
WISSENSCHAFTLICHER BEIRAT
Der Beirat der FuE-Erhebung berät die Wissenschaftsstatistik und das BMFTR zu methodischen und inhaltlichen Fragestellungen und unterstützt die wissenschaftliche Weiterentwicklung der Erhebung. Die Mitglieder des Beirates werden vom BMFTR berufen und stammen aus der wissenschaftlichen und methodischen Fachcommunity, aus Unternehmen, von der OECD und aus dem Statistischen Bundesamt.
Mitglieder des Beirates sind aktuell:
- Ruth Brand, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden
- Prof. Dr. Dirk Czarnitzki, Katholische Universität Leuven
- Dr. Gernot Füchsel, Kipu Quantum GmbH, Karlsruhe
- Christian Herbst, Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt, Berlin
- Dr. Karen Köhler, Bayer AG, Leverkusen
- Prof. Ph.D. Pierre Mohnen, MERIT University of Maastricht (Niederlande)
- Prof. Dr. Ingrid Ott, Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (Vorsitzende des Beirats)
- Dr. Caroline Paunov, OECD – Organisation for Economic Co-Operation and Development, Paris
- Prof. Dr. Bettina Peters, Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH, Mannheim
- Prof. Dr. Vivien Procher, Philipps-Universität Marburg
- Dr. Ulrich Romer, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin
- Dr. Mirjam Storim, Siemens Technology Center, Garching
- Dr. Ulrike Tagscherer, KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg
- Carsten Wehmeyer, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Berlin
- Prof. Ph.D. Axel Werwatz, Technische Universität Berlin