
Open Innovation – Verbreitung, Nutzen, Erfolgsfaktoren
Relevante Erfolgsfaktoren und Hindernisse bei der Umsetzung
von Open Innovation in Deutschland

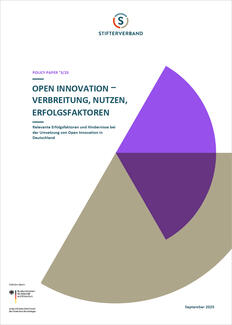
Die Kernaussagen des im September 2025 veröffentlichten Policy Papers:
- Bisherige Messungen zum Innovationsgeschehen unterschätzen Innovationsaktivitäten von Unternehmen in Deutschland, da offene Innovationspraktiken nicht systematisch erfasst werden.
- Laut einer Studie von Stifterverband und RWTH Aachen nutzen 85 Prozent der deutschen Unternehmen offene Innovationspraktiken.
- Ein Drittel aller kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) investiert mehr als 20 Prozent aller Aufwendungen für Innovation in die Durchführung von Open-Innovation-Praktiken.
- Als Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung von offenen Innovationspraktiken wurden Aktivitäten zur aktiven Steuerung externer Partnerschaften sowie die dezentrale Verteilung von Innovationsprozessen innerhalb eines Unternehmens identifiziert.
- Zentrale Hindernisse in der Umsetzung sind ungewollter Wissensabfluss zu Wettbewerbern, unternehmenskulturelle Aspekte sowie Ressourcenmangel.
- Um die Potenziale offener Innovationspraktiken in der deutschen Wirtschaft vollständig auszuschöpfen, sind Maßnahmen erforderlich, um geistiges Eigentum effektiv zu schützen, kulturellen Wandel hin zu mehr Offenheit und Kollaboration anzustoßen sowie gezielte Förderprogramme zur Stärkung von Innovationsnetzwerken.
In den vergangenen Jahren sind Kanäle und Formen von Wissenstransfer in Innovationsprozessen vielfältiger geworden und gerade offene Innovationspraktiken gewinnen zunehmend an Bedeutung. Solche offenen Innovationspraktiken haben als zentrales Paradigma die Innovationsdiskussion in Unternehmen, der öffentlichen Verwaltung und wissenschaftlicher Forschung geprägt. In offenen Innovationsprozessen dienen der zielgerichtete Zufluss externen Wissens und der kontrollierte Abfluss internen Wissens eines Unternehmens an externe Partner dazu, die Entstehung von Innovationen zu begünstigen und zu beschleunigen.
Im Gegensatz zur klassischen Form der Kollaboration betonen offene Innovationspraktiken wechselseitige Austauschbeziehungen und Beiträge einer breiten Zahl an externen Akteuren, von technisch-wissenschaftlichen Partnern wie Lieferanten, Wettbewerbern und Forschungsinstituten, aber auch von marktlichen Partnern wie Kunden und Konsumenten sowie Partnern aus anderen Branchen. Diese Partner werden durch organisatorische Arrangements integriert, die sich oft durch informale Ad-hoc-Beziehungen, zum Beispiel über Crowdsourcing-Plattformen, oder durch andere IP-Arrangements (Intellectual property) als klassische Lizenzabkommen, zum Beispiel Open-Hardware-Communities, auszeichnen.
In den klassischen Instrumenten zum Monitoring des Innovationsgeschehens in Deutschland werden derartige offene Innovationspraktiken derzeit nur unzureichend abgebildet und systematisch unterschätzt. Aus diesem Grund trägt eine Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Verbreitung von offenen Innovationspraktiken dazu bei, deren Sichtbarkeit unmittelbar zu erhöhen und mittelfristig Möglichkeiten zu deren Steuerung und Förderung aufzuzeigen.
Der Open Transfer Index ist ein vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördertes Projekt des Stifterverbandes und der RWTH Aachen, um Ausprägung und Bedeutung offener Innovationsprozesse in Unternehmen eingehend zu untersuchen. Die Studie hatte zum Ziel, eine präzisere Bewertung des deutschen Innovationssystems zu unterstützen. An der Umfrage haben über 200 innovationsaktive Unternehmen in Deutschland teilgenommen.
DIE AUTORINNEN UND AUTOREN DES PAPERS
Nicholas Schwarz
Wissenschaftlicher Mitarbeiter, RWTH Aachen
Marian Burk
Wissenschaftlicher Referent, Stifterverband
Lena Finger
Wissenschaftliche Referentin, Wissenschaftsstatistik im Stifterverband
Pascal Hetze
Programmleiter Kollaborative Forschung & Innovation, Stifterverband
Gero Stenke
Geschäftsführer, Wissenschaftsstatistik im Stifterverband
David Antons
Leitung Lehrstuhl für Entrepreneurship und Innovationsmanagement
im Agribusiness, Universität Bonn