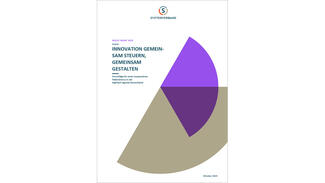Missionsorientierte Forschungs- und Innovationsstrategien
Implementierung und Umsetzung in föderalen Regierungssystemen

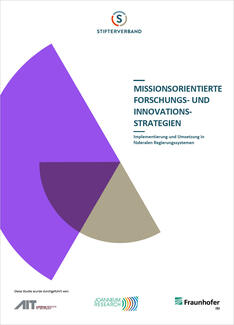
Während missionsorientierte Ansätze zunehmend in die praktische Anwendung überführt werden und international und auch in Deutschland zunehmend in die Umsetzung kommen, stellt sich die Frage, wie die Wirkungskraft dieser Ansätze gestärkt werden kann. Ein zentraler – und bislang nur wenig thematisierter – Ansatzpunkt stellt die Einbindung der subnationalen Ebene in die Missionsumsetzung dar. Im deutschen Kontext hat dieser Aspekt vor dem Bekenntnis der neuen Bundesregierung zur Entwicklung einer neuen "Hightech Agenda für Deutschland unter Einbindung der Länder" an Bedeutung gewonnen.
Die im Oktober 2025 veröffentlichte Studie betrachtet diese Fragestellung auf Basis der Analyse von insgesamt 23 Good-Practice-Beispielen internationalen missionsorientierten Initiativen (darunter acht vertiefende Fallstudien ausgewählter Initiativen). Zusätzlich wurden die Einsichten aus der Analyse im Rahmen eines internationalen Workshops mit Missionspraktikern, Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen diskutiert.
Schwerpunkt der Analyse sind die folgenden Fragen:
- Was sind geeignete Formen für die Einbindung subnationaler Akteure?
- Wie können Missionen im Mehrebenensystem sinnvoll formuliert und ausgestaltet werden?
- Was sind geeignete Governance-Arrangements für die Umsetzung solcher Missionen?
- Welchen Beitrag können Roadmapping oder ähnliche Prozesse zur Koordination und Abstimmung zwischen verschiedenen Akteuren leisten?
Im Rahmen der Analyse wurden sechs verschiedene Formen der subnationalen Beteiligung identifiziert, die von einer eher begrenzten Einbindung in Form von Wissensträgern hin zu stärker dezentralisierten Formen der Missionsumsetzung in Form von Co-Creation, regionalem Experimentieren oder der Entwicklung spezifischer subnationaler Lösungen reichen. Diese unterschiedlichen Formen der Beteiligung folgen dabei unterschiedlichen Handlungslogiken und Zielsetzungen. Dabei zeigen sich nicht nur substanzielle Unterschiede zwischen Ländern, sondern sogar innerhalb einzelner Strategien.
Auch bei der Nutzung von Roadmapping-Elementen zeigen sich Unterschiede im Ausmaß der Nutzung und in den Formen/Zeitpunkten der Einbindung. Klare Zielformulierungen, messbare Meilensteine/Zwischenziele, die Konzeption eines begleitenden Monitorings/Evaluationsprozesses und eine visualisierte Darstellung der Entwicklungspfade sind in vielen Initiativen eine gängige Praxis, wohingegen die Analyse von Katalysatoren und Szenarien deutlich seltener anzutreffen ist. Während sich im Hinblick auf die Einbindung verschiedener Akteursgruppen kein klares Bild ergibt, scheint die Einbindung insbesondere in der Umsetzungsphase stattzufinden, während Beteiligung bei der Formulierung und dem Design der Mission seltener anzutreffen ist.
Im Rahmen der verschiedenen Fallstudien wurden insbesondere die folgenden zentralen Einflussfaktoren auf die Ausgestaltung der Ansätze identifiziert.
- Institutioneller Kontext und Kompetenzverteilung: Während eine dezentralisierte Staatsstruktur subnationale Beteiligung in Missionen fördert, ist am Ende die Kompetenzausstattung der jeweiligen Akteure im missionsrelevanten Themenfeld entscheidend.
- Bestehende Politiktraditionen und vorhandene Kompetenzen: Der Großteil der Initiativen baut auf einer graduellen Weiterentwicklung bestehender Strukturen auf, die im Missionskontext angepasst wurden. Gleichzeitig können externe Politikimpulse (wie etwa EU-Missionen) eine wichtige Rolle spielen.
- Akteursstrukturen und Ressourcen: Die verfügbaren Ressourcen/Mandate des Mission-Owners aber auch der subnationalen Akteure führen zu verschiedenen Strategien einer verbesserten Anreizsetzung. Dazu gehören eine Schärfung des Missionsfokus bzw. auch Formen einer stärkeren asymmetrischen Beteiligung, um Mobilisierungs- und Koordinationskosten zu senken.
Vor dem Hintergrund der Analyseergebnisse werden im Hinblick auf den bundesdeutschen Kontext eine Reihe von Einsichten für eine verstärkte subnationale abgeleitet:
- Wie können subnationale Akteure eingebunden werden? Deutschland besitzt durch seine föderale Struktur mit starken Bundesländern ein hohes – bislang ungenutztes – Potenzial für eine stärkere Beteiligung von regionalen Akteuren auch in anspruchsvollen Kooperationsformaten. Eine verstärkte subnationale Einbindung kann dazu beitragen, die Schlagkraft der Missionsumsetzung zu steigern, bestehende Mobilisierungsprobleme zu überwinden und langfristig die Stabilität der Missionsumsetzung zu gewährleisten.
- Welche Art von Missionen eignet sich für Missionen mit subnationaler Beteiligung? Die spezifische Art der Einbindung auf subnationaler Ebene wird durch die Mission, ihre Regelungen, Finanzierung und Handlungskompetenzen bestimmt. Gleichzeitig sollte eine stärkere Synergie mit bestehenden EU-Strategien angestrebt werden und die Umsetzung von Missionen für stärker ausdifferenzierte Beteiligungsmöglichkeiten geöffnet werden, die die unterschiedliche Betroffenheit bzw. Schwerpunktsetzung verschiedener subnationaler Akteure reflektiert. Mögliche Beispiele für Anwendungen in diesem Zusammenhang könnten Regionalentwicklung/Strukturwandel oder Digitalisierung sein.
- Wie sollte die praktische Umsetzung von Missionen mit subnationaler Beteiligung ausgestaltet werden? Wichtige Bausteine können hier unter anderem sein: eine aktivere und kontinuierliche Einbindung subnationaler Akteure über den gesamten Missionsprozess hinweg, ein stärker dynamisches Umsetzungsverständnis mit einem portfolio-basierten Missionsansatz und flexiblen Beteiligungsformen sowie der gezielte Rückgriff auf bestehende Strukturen und Netzwerke zur Stakeholder-Mobilisierung.
Aus dem Inhalt
- Missionsorientierung in Mehrebenensystemen
- Methodisches Vorgehen und Datenquellen
Screening relevanter Initiativen und vertiefte Länderfallstudien
Internationaler Workshop mit Expertinnen und Experten
- Überblick über Einsichten aus dem internationalen Vergleich
Formen von subnationaler Beteiligung
Roadmapping-Prozesse
Einflussfaktoren für Ausgestaltung und Umsetzung von regionaler Beteiligung und Roadmapping
- Ableitungen und Handlungsempfehlungen
Welche Arten der subnationalen Einbindung bei der Umsetzung von Missionen?
Welche Missionen sind für subnationale Beteiligung geeignet?
Was ist bei der praktischen Umsetzung von Missionen mit subnationaler Beteiligung zu beachten?
Die acht Fallstudien
- Australien: TowardsNetZero Mission
- Belgien: Agri-food Chains & Circular Materials (SIAs)
- Japan: Automated Driving Systems (Adus 1 & 2)
- Niederlande: Circular Economy Mission / Transition agenda Konsumgüter
- Österreich: EU-Mission "Klimaneutrale Stadt"
- Schweden: Impact Innovation
- Spanien: EU Mission Climate Adaption
- Tschechien: National Mission of Resource Productivity